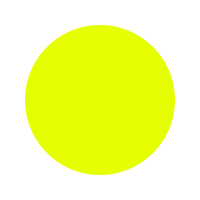Oktober 1894
Josef Deutschmann wurde am ersten Oktober 1894 in Windhuk in ehemals Deutsch-Südwestafrika, im heutigen Namibia, geboren. Den Homburger Neuesten Nachrichten zufolge starben seine Eltern kurz nach seiner Geburt, weswegen er in die Obhut von deutschen Farmer*innen genommen wurde. Warum seine Eltern sterben mussten, ist heute aufgrund der Quellenlage nicht mehr zu rekonstruieren. In einem Interview mit einem Zeitzeugen aus Hünfeld beschreibt dieser die Umstände und berichtet von einem deutschen Offizier, welcher die Farm bei Windhoek besaß und gleichzeitig der Vater von Josef Deutschmann gewesen sei. Dieser hätte demnach Josef Deutschmann nach dem Verkauf der Farm mit ins Deutsche Reich genommen. Auch diese Angaben zur Ankunft Josef Deutschmanns im Deutschen Reich können nicht vollständig belegt werden, jedoch besaß Josef Deutschmann die deutsche Staatsbürgerschaft, welche nach damaligem deutschen Gesetz väterlicherseits vererbt wurde.
1896
In einem in der Fuldaer Zeitung abgedrucktem Artikel vom 11.April 1931 berichtete Josef Deutschmann über seine Ankunft im Deutschen Reich und in der hessischen Kleinstadt Hünfeld bei Fulda im Jahr 1896. Es ist anzunehmen, sollte der Offizier der Vater von Josef Deutschmann sein, dass ihm deshalb dieser Name entweder in seinem Geburtsland oder bei der Ankunft im Deutschen Reich zugeschrieben wurde. Da sicherlich keine eheliche Verbindung zu dem Offizier und seiner Mutter bestand, hätte Josef eigentlich den Namen der Mutter bei Geburt erhalten, die genauen Umstände dazu sind jedoch unklar. Josef als Vorname passt dabei zu der christlich-katholischen Prägung seines Lebensmittelpunktes in der Kleinstadt Hünfeld (Hessen).
1904
Erste Verbindungen zwischen Josef Deutschmann und dem Hünfelder Kloster der Oblaten wurden von Deutschmann in dem Artikel der Fuldaer Zeitung auf das Jahr 1904 datiert. Dass Deutschmann im Zuge der Missionierung nach Deutschland verschleppt wurde, erscheint wegen seiner eigenen Darstellungen im Artikel unwahrscheinlich, wenngleich die missionarische Tätigkeit des Ordens zu einer Kontaktaufnahme geführt haben könnte. Da das Kloster zu dieser Zeit über Ausbildungsstätten und diverse Arbeitsgemeinschaften verfügte, aber auch Arbeitsplätze, die der Unterhaltung der Institution dienten, ist es denkbar, dass Deutschmann hier seinen Beruf als Elektroinstallateur lernte und aufnahm.
Juli 1928
Am 31. Juli 1928 wird in der Fuldaer Zeitung von einem katholischen Gesellenvereinsfest in Würzburg berichtet, zu dessen Anlass Josef Deutschmann im Namen des Kolpingverbandes aus Fulda eine Rede hielt. Besonders fällt dabei die Formulierung „[…] die Worte des typischen Hünfelder Vertreters Deutschmann, dessen Heimat in Afrika liegt […]“ auf, indem das Adjektiv „typisch“ vermuten lässt, dass Josef Deutschmann als Person im regionalen Umkreis bereits bekannt war. Dass an dieser Stelle auch seine Herkunft erwähnt wurde, diente offensichtlich nicht nur zum Verstehen des Textes, sondern zeigte eine Form des Otherings, welche ihn als Person von den anderen Mitgliedern des Vereins differenzierte.
April 1931
Drei Jahre später wurde in der Fuldaer Anzeiger ein Artikel mit dem Titel „Schwarze Zwillinge – Weiße Eltern“ veröffentlicht, der das klare Ziel hatte Josef Deutschmann rassistisch zu verleumden. Besonders relevant erscheint dabei die Erwähnung seines Familienstandes, wobei Deutschmann betonte, dass er unverheiratet sei. In diesem Zusammenhang weist dies auf schwierige und diskriminierende Situation für Schwarze Menschen in Bezug auf Eheschließungen mit weißen Partner*innen hin. Wäre Deutschmann somit mit einer weiß gelesenen Frau liiert gewesen oder hätte mit ihr Kinder bekommen, hätte dies auch vor der NS-Zeit zu gesellschaftlicher Verachtung geführt. Das Statement von Deutschmann ist somit als eine mutige Zurückweisung zu den rassistischen Vorwürfen hinsichtlich der unterstellten Vaterschaft der Zwillinge zu verstehen, indem er sich öffentlich gegen die Verleumdung stellte.
Februar 1941
Am 26. Februar 1941 wurden die Oblaten aufgrund angeblicher Verfehlungen gegen Lebensmittelvorschriften von Nationalsozialist*innen aus dem Bonifatiuskloster in Hünfeld vertrieben. Fast alle der Oblaten, außer jene, welche handwerkliche Berufe ausübten, wurden aus dem Gau Hessen vertrieben. Deutschmann blieb jedoch in der Stadt Hünfeld wohnen. Jedoch bot das Kloster ihm fortan keinen Schutz vor rassistischer Gewalt durch die nationalsozialistische Gesellschaft, was zu zunehmender sozialer Isolation führte.
November 1942
Im Oktober 1942 erließ der SS-Reichsführer Himmler den Befehl zur statistischen Erfassung aller Schwarzen Menschen, welche zu diesem Zeitpunkt im Deutschen Reich lebten. Da schon vor der Erfassung viele Schwarze Menschen in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert worden waren, erhöhte die Anordnung die Zahl der Deportationen nicht in großem Maße. Josef Deutschmann war von der statistischen Erfassung auch betroffen und wurde in Hünfeld am sechsten November 1942 von der Polizei behördlich erfasst. Darin wurde auch seine deutsche Staatsangehörigkeit festgestellt, welche er auch in seinem Statement in der Fuldaer Zeitung angegeben hatte. Über diese Zeit liegen ansonsten keinerlei Dokumente zu seinem Verbleib vor.
Januar 1944
Am 26. Januar 1944 starb Josef Deutschmann aller Wahrscheinlichkeit mit Leberzirrhose und nach langer Alkoholkrankheit, wie ein Zeitzeuge berichtet, in Hünfeld. Gründe für seine Krankheit könnten psychische Belastungen aufgrund seiner rassistischen Erfahrungen und gesellschaftlichen Isolation gewesen sein. Er wurde anschließend auf dem Hünfelder Friedhof beerdigt. In der Fuldaer Zeitung vom 28. Januar 1944 lässt sich eine Todesanzeige von Deutschmann finden.
Bildnachweise
- Kachel: Archiv DRK Hünfeld, aus: Stoll, Klaus Hartwig (2002): Die Rotkreuzbewegung im Altkreis Hünfeld. Gestern und heute. 50 Jahre Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hünfeld e.V. 1952-2002. Hünfeld: DRK-Kreisverband, S. 21.
- Banner: Archiv DRK Hünfeld, aus: Stoll, Klaus Hartwig (2002): Die Rotkreuzbewegung im Altkreis Hünfeld. Gestern und heute. 50 Jahre Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hünfeld e.V. 1952-2002. Hünfeld: DRK-Kreisverband, S. 21.